Ein Großteil der Autos auf Usbekistans Straßen sind enge Verwandte des Opel Kadett E, die in Usbekistan gebaut und unter dem Namen Chevrolet Nexia oder Daewoo Nexia verkauft werden. Auch alle Kombinationen sind möglich, so findet sich beispielsweise ein Daewoo Nexia mit Chevrolet Emblem. Der größte Unterschied zum Kadett besteht in einem alternativen Design der Sitze, die als besonderes Feature willkürlich verteilte Metallbügel enthalten. Da Importfahrzeuge praktisch nicht verfügbar sind, kann man den um Kundschaft buhlenden Taxifahrern nicht wirklich verübeln, dass sie ihre Nexias als besonders komfortabel anpreisen. Alternative gibt es jedenfalls nicht. Ein kleiner Daewoo Nexia, ein ebenso kleiner Chevrolet Nexia oder ein ungefederter Damas, der wohl kleinste „Minivan“ der Welt. Viel Mühe gibt man sich nicht, den Anschein dieser Modellvielfalt aufrechtzuerhalten, die unter verschiedenen Markennamen angebotenen Fahrzeuge sind bis auf das kleinste Detail identisch. Für Abwechslung und Farbtupfer im Grau der Autos sorgen lediglich einige alte, oft liebevoll gepflegte Ladas.
Auf dem Weg von Bukhara nach Khiva waren wir 10 Personen, da wir seit Taschkent immer wieder die selben Leute trafen. Der Versuch, ein größeres Auto zu organisieren, das uns alle günstiger befördern könnte, war von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Es fand sich lediglich ein Damas, in den man sieben Personen quetschen könnte. Die nicht mehr ganz so freundlichen Nexia Taxifahrer, die uns mit ihren Komfortargumenten nicht wirklich ködern konnten und deren „wir geben uns uninteressiert“ Verhandlungstaktik nicht funktionierte, gingen dann dazu über, den Fahrer des Damas zu bedrohen. Anscheinend benötigt man eine Lizenz, um Ausländer zu transportieren, oder man muss die richtigen Leute schmieren. Als dann noch die Freundin des Damas Fahrers hinzu kam und begann, diesen mit ihrer Handtasche zu verprügeln, war auch diese Option dahin und wir mussten uns sehr zur Freude der Fahrer auf drei “bequeme“ Nexia Kamele verteilen. Es folgte eine sechsstündige Fahrt auf einer Rumpelstrecke mitten durch die Wüste. Auch in solch abgelegenen Gebieten finden sich allerdings wegelagernde Polizisten, die ihre fest installierten Kontrollstationen für einen lukrativen „Händedruck“ mit den Fahrern nutzen.


Khiva ist nach Samarkand und Bukhara die dritte gut erhaltene historische Stadt in Usbekistan. Kleiner als die beiden anderen war Khiva allerdings die erste Stadt auf der Kulturerbe-Liste der UNESCO. Die Stadt wird von zwei hohen Minaretten und einem dritten nie fertig gestellten Minarett dominiert. Dieses dritte Minarett, Kalta Minor, sollte angeblich hoch genug gebaut werden, um von der Spitze aus Bukhara erblicken zu können. Da es allerdings nie fertig gestellt wurde, wirkt Kalta Minor heute eher wie ein hübsch dekorierter kleiner Kühlturm.





Schafswollmütze






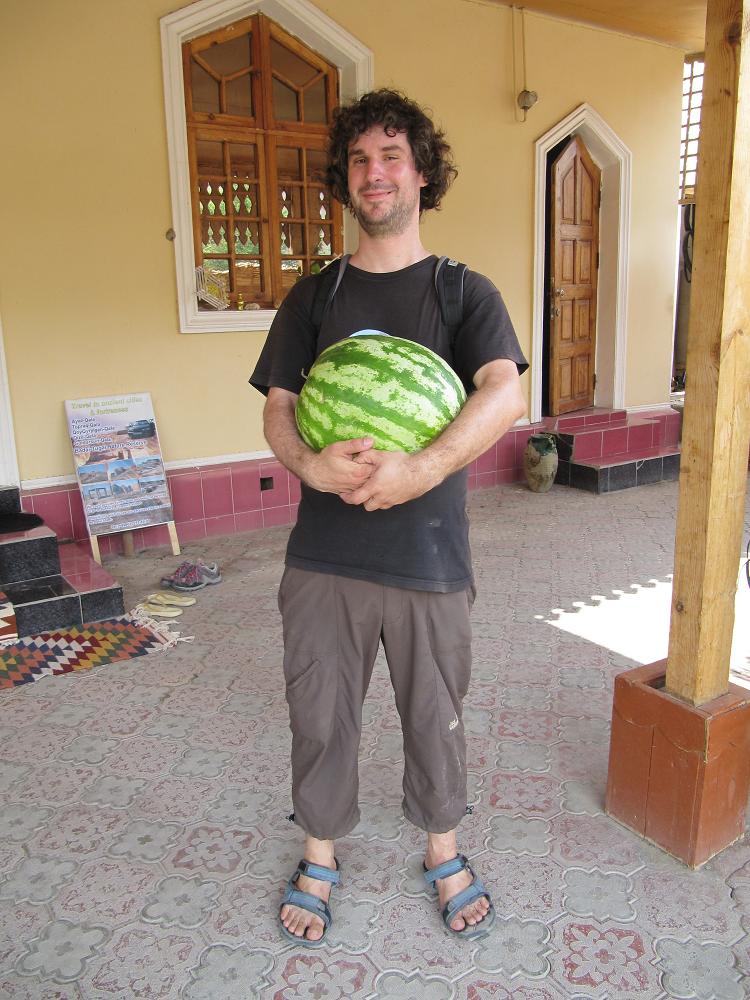
14 kg!

Ania´s Geburtstagsbowle

Von Khiva aus ging es weiter zur ehemaligen Küste des Aralsee. Die Menschen in diesem Teil des Landes sind keine ethnischen Usbeken mehr, sondern erinnern mit ihren hohen Wangenknochen eher an Kirgisen. Moynaq war einst sowjetische Hafenstadt mit großer Fischfangflotte und Fischkonservenfabrik. Nachdem allerdings immer mehr Wasser aus den Zuflüssen des Sees entnommen wurde, um die Baumwollproduktion in der Wüste zu steigern, fiel der Wasserstand des Sees seit den 60er Jahren stetig. Ende der 70er Jahre war Moynaq keine Hafenstadt mehr und mittlerweile beträgt die Fahrzeit zu den kläglichen Resten des Sees vier Stunden. In ein paar Jahren sollen aber auch diese Reste verschwunden sein. Zwar war schon zu sowjetischer Zeit absehbar, dass die Wasserentnahme zu einer Katastrophe führen wird, allerdings entschloss man sich, die Nachteile in Kauf zu nehmen, um die Baumwollproduktion nicht zu gefährden. Auch nach der Unabhängigkeit Usbekistans blieb die Regierung dem Baumwollanbau treu und zwingt die Bauern bis heute, Baumwolle im großen Stil anzubauen. Neben Timur wurde Baumwolle zum festen Bestandteil nationaler Identität und Ehre. Reiterkrieger in Baumwollunterhosen sozusagen. Der Baumwollanbau hat tatsächlich eine lange Tradition in Usbekistan und es scheint viele Flächen zu geben, die sich hervorragend dazu eignen. Das Festhalten an der sowjetischen Überproduktion auf Kosten der gesamten Umwelt und anderer Industriezweige erscheint allerdings auch wirtschaftlich als ziemlicher Nonsens.
Infotafeln an der vormaligen Küstenlinie in Moynaq zeigen den Rückgang des Sees ungeschminkt, erwähnen allerdings mit keinem Wort den Zusammenhang von Baumwollanbau und Austrocknung des Sees. Eine kleine Ausstellung im Naturkundemuseum in Khiva ist dem „Wohlstand des Landes“ gewidmet. Hier werden in grotesker Weise Baumwollbüsche neben Bildern von Fischern auf dem Aralsee ausgestellt, die den Fischreichtum Usbekistans zeigen sollen. Noch scheint bei den alten sowjetischen Eliten, die das Land unter ihrer Sichel haben, ein Bewusstsein dafür zu fehlen, das Wunsch und Wirklichkeit nicht ein und dasselbe sind.
Moynaq selber wird von vielen ausländischen Katastrophentouristen besucht, die eine Stadt in Mad Max Weltuntergangsstimmung am Ende der Welt erleben und auf Fotos festhalten möchten. Tatsächlich unterscheidet sich Moynq allerdings nicht von vielen anderen Städten der ehemaligen Sowjetunion, deren Hauptarbeitgeber in Insolvenz ging. Ein Paradies wird Moynaq auch zu besseren Zeiten nicht gewesen sein. Das wirklich Surreale sind die klar erkennbare Küstenlinie, die von Muscheln übersäten Sanddünen sowie die langsam vor sich hinrostenden Schiffe vor dem Anblick einer endlosen Wüste. In gewisser Weise wirken die Schiffe zwar deprimierend, aber in der Abendsonne haben sie doch etwas sehr Ästhetisches. Und für Leben sorgen die Kinder, die geschickt an den rostenden Booten emporklettern und sich über schwerfällige Touristen amüsieren, die ihren Abenteuerspielplatz unsicher erklimmen. Dies alles kann allerdings nur scheinbar über die Katastrophe hinwegtäuschen, die der politischen Führung ein Armutszeugnis ausstellt. Ich wüsste mal gerne, wie viel Geld der Baumwollexporte in den Taschen der politischen Führungsriege hängen bleibt.






Die letzten Tage in Usbekistan verbrachten wir in Nukus, der Hauptstadt der Provinz Karakalpakstan, die insgesamt durch das Verschwinden des Aralsees betroffen ist. Zu Zeiten der Sowjetunion konnte in Nukus allerdings der Direktor des Museums für Regionalgeschichte eine große Anzahl an Bildern von Avantgardekünstlern zusammentragen, die in der Sowjetunion wenig geschätzt, geächtet oder ignoriert wurden. Diese Sammlung wurde auch im unabhängigen Usbekistan wenig geschätzt, und Anfang des neuen Jahrtausends war die Sammlung kurz vorm Verrotten. Seitdem ist dank ausländischer Förderer viel passiert, und mitten in dieser abgelegenen Stadt steht ein neues Museum, das den Namen des Gründers Savitsky trägt. Ausgestellt werden bisher wenig bekannte russische Avantgardekünstler, die ausländische Touristen von der Seidenstraße abkommen lassen und in diese abgelegene Wüstenprovinz locken. Der Museumsgründer selber hat immer prophezeit, dass eines Tages Menschen aus Paris nach Nukus kommen würden, um sich das Museum anzuschauen.
